Ode an das Butterbrot
Jeder Tag ist würdig, das Zusammenspiel von Brot und Butter als sinnliches Erlebnis zu ehren.
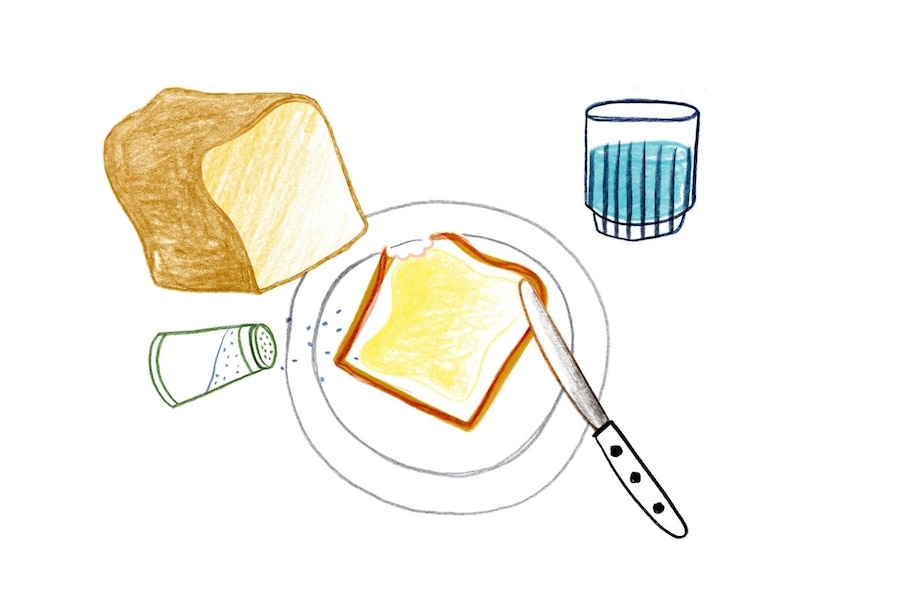
Bild: Julia Zott
Es war mir von Kindheit an ein treuer Wegbegleiter, anmutig und herzhaft. Aber nie war ich so sehr von ihm fasziniert wie an jenem Tag, als mir Dimitrij, mein Freund aus Wolgograd, in einer Schulpause erzählte, dass man es auch in seiner Heimat „buterbrod“ nennt. Diese sprachliche Besonderheit hat so viel verblüffenden Charme, dass ich keinen Bissen mehr davon tun kann, ohne das zu erzählen.
Zumal ich das Butterbrot so oder so als unverzichtbares kulinarisches Meisterwerk erachte. Oder, wie es Gunther Hirschfelder, Professor für Vergleichende Kulturwissenschaften, sagt: „Das Butterbrot ist in unser kulturelles Gedächtnis eingraviert.“ Und es erlebt jetzt, da die Menschen zunehmend erkennen, dass Döner und Pizza, Hotdog und Burger niemals ein geschmacklicher Ersatz sein können, eine wahre Wiederentdeckung. Ja, liebes Butterbrot, du bist wieder wer.
Das Butterbrot ist in unser kulturelles Gedächtnis eingraviert.
Gunther Hirschfelder, Professor für Vergleichende Kulturwissenschaften
Seit bald zwanzig Jahren gibt es den Tag des Butterbrots. Als wäre nicht jeder Tag würdig, das Zusammenspiel von Brot und Butter als sinnliches Ereignis zu ehren. Wohl wissend: Mit elegant-gemächlicher Handgelenkskunst die Butter auf einer Scheibe Brot zu verteilen weckt tausend Erinnerungen an die Kindheit. Es ist die wunderbare Symbolik der Einfachheit, die Lust auf das Unkomplizierte, die Gewissheit geschmacklicher Verlässlichkeit, die dich bis in alle Ewigkeit unbesiegbar macht.
Meine Großmutter, die uns Kindern die großen Butterbrotscheiben immer in appetitliche Streifen schnitt, sagte gerne mit dem Lächeln einer Frau, die wusste, was Hunger und Not bedeuten: „Wichtig ist ein gutes Brot. Immer. Merkts euch das!“ Und dann durften wir Salz auf die Butter rieseln lassen. Oder Schnittlauch. Oder Brunnenkresse. Oder die Butter auch einfach nur Butter sein lassen. Und wehe jenen Enkerln, die nicht zu würdigen wussten, welchen Schatz sie in Händen hielten und welchen Wert die Kunst des richtigen Schmierens besitzt – schön gleichmäßig, nicht zu dick, nicht zu dünn. Lebensgefühl heißt das. Wer auf die Butterseite fällt, landet im Glück.
Der niederländische Maler Pieter Bruegel zeigt auf seinem um 1568 entstandenen Gemälde „Die Bauernhochzeit“ ein Kind, das im Vordergrund neben der Festtafel auf dem Boden sitzt, in seinem Schoß ein Butterbrot. Ein angebissenes, wohlgemerkt. Was für ein Blickfang! Auch über vierhundert Jahre später wirkt die Szene so grandios zeitgenössisch – das Butterbrot als Sinnbild für Verfügbarkeit und kulinarische Hingabe.
Große Kunst. Im Kopf möglicherweise musikalisch begleitet … von einem Streichorchester.
von Michael Hufnagel


